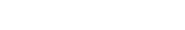Welches Modell wird Brasilien bei seiner Entkriminalisierung von Cannabis anwenden?

In einer Entscheidung vom 14. Februar 2025 entkriminalisierte der Oberste Bundesgerichtshof Brasiliens (STF) einstimmig den Besitz von Cannabis für den persönlichen Gebrauch – bis zu 40 Gramm oder sechs weibliche Pflanzen.
Diese Entscheidung markierte eine wichtige Änderung im drogenpolitischen Ansatz des Landes, wirft aber auch Fragen über die Umsetzung, Anwendung und die tatsächlichen Auswirkungen der Entkriminalisierung von Cannabis auf die soziale Gerechtigkeit auf.
Ein zehn Jahre langer Rechtsstreit
Die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs beendete eine jahrelange Rechtsunsicherheit, die mit einem Fall aus dem Jahr 2011 begann, in dem es um nur drei Gramm Cannabis ging. Mit dieser Entscheidung befasste sich der STF mit Artikel 28 des brasilianischen Betäubungsmittelgesetzes von 2006, der bis dahin jeden noch so kleinen Besitz kriminalisierte und oftmals eine Haftstrafe oder gemeinnützige Arbeit nach sich zog.
Richter Gilmar Mendes leitete die Entscheidung und machte eine klare Unterscheidung zwischen persönlichem Gebrauch und Handel. Von nun an müssen Personen, die im Besitz von maximal 40 Gramm erwischt werden, mit Verwaltungsstrafen – Warnungen oder Präventionskursen – rechnen, anstatt strafrechtlich verfolgt zu werden. Das Vorhandensein von Waagen, Verpackungen oder Aufzeichnungen kann jedoch immer noch zu Anklagen wegen Drogenhandels führen, die mit Strafen zwischen 5 und 15 Jahren belegt werden können.
Die Reform kommt zu einer Zeit, in der die Bevölkerung in brasilianischen Gefängnissen über 888.000 Menschen beträgt, von denen mehr als 200.000 wegen Drogendelikten inhaftiert sind, was schwarze und arme Brasilianer unverhältnismäßig stark betrifft.
Wie Agência Brasil berichtet, sind fast 25% von ihnen wegen kleiner Besessenheit inhaftiert, was die systemischen Ungleichheiten zwischen Rassen und sozialen Klassen verdeutlicht.
Eine „gesundheitsorientierte“ Politik oder eine Maske für Zwang?
Nach der Entscheidung des STF führten das brasilianische Justizministerium und der Nationale Justizrat eine neue „gesundheitsbasierte“ Antidrogenpolitik ein. Inspiriert – zumindest nominell – vom Portugiesischen Entkriminalisierungsmodell, werden mit diesem Ansatz Fälle von persönlichem Besitz von den Strafgerichten abgezogen und den Zentren für den Zugang zu Rechten und soziale Eingliederung (CAIS) übertragen.
Kritiker warnen jedoch, dass dieser Rahmen eher strafend als progressiv sein könnte. Wie eine politische Analyse aus dem Jahr 2024 zeigt, fungieren die CAIS-Zentren als eine Art Drogengericht, dessen Personal nicht aus Richtern besteht, sondern aus Teams von Sozialarbeitern, Rechtsassistenten und Gesundheitspersonal. Obwohl dies auf dem Papier eine humane Alternative zu sein scheint, kann es in der Praxis wie eine Zwangsbehandlung funktionieren.
„Wenn das Team der Meinung ist, dass die Person, die es beurteilt, ein ausreichendes Risiko darstellt – vielleicht aufgrund von Rasse, Armut, psychischen oder Verhaltensproblemen oder fehlenden Dokumenten – könnte diese Person leicht auf Behandlungswege verwiesen werden, die weder wirksam noch freiwillig sind“, warnte eine Quelle.
Therapeutische Gemeinschaften unter Beobachtung
Viele der an diese Zentren verwiesenen Personen dürften sich in konfessionellen Therapeutischen Gemeinschaften wiederfinden, die in Brasilien seit langem mit einem Minimum an Regulierung funktionieren.
Menschenrechtsorganisationen haben diese Zentren als Zwangsarbeitslager beschrieben, in denen die Bedingungen oft gegen die Menschenwürde verstoßen. Ihre engen Verbindungen zur Lula-Regierung verschärfen die Bedenken hinsichtlich einer Politisierung der Behandlung von Drogenabhängigkeit.
Im Jahr 2022 forderte die ehemalige Gesundheitsministerin, Nísia Trindade, eine völlige Neugestaltung dieser Gemeinschaften und empfahl, unfreiwillige Verpflichtungen zu beenden und mehr in evidenzbasierte Praktiken zu investieren. Seine Entlassung im Februar 2025 und das Verschwinden seines Berichts von den offiziellen Webseiten deuten auf eine Abkehr von der wissenschaftlichen Politikgestaltung hin.
Das portugiesische Modell: Eine falsch genutzte Inspiration?
Die Entkriminalisierung von Drogen in Portugal – oft als Erfolg bezeichnet – funktionierte, weil sie mit Programmen zur Schadensminderung, Öffentlichkeitsaufklärung und freiwilligen und säkularen Behandlungen verbunden wurde. Zwar konfiszieren die portugiesischen Behörden Drogen, die für den persönlichen Gebrauch bestimmt sind, doch ist eine Behandlung nie obligatorisch und Dienstleistungen wie Nadeltausch sind üblich.
Das brasilianische CAIS-Modell hingegen verfügt nicht über die Infrastruktur und die Garantien, die für eine echte Reform erforderlich sind. Nur 22 Zentren sind derzeit in Betrieb, und fast 100 weitere befinden sich noch in der Entwicklung. Die Projekte zur Beurteilung per Videoanruf verdeutlichen den Mangel an Ressourcen und geben Anlass zur Sorge über die Ordnungsmäßigkeit der Verfahren und die individuelle Betreuung.
Brasilien steht nun an einem Scheideweg: Wird es ein Modell übernehmen, das in der Schadensminderung und der sozialen Gerechtigkeit verankert ist, oder wird es ein Strafsystem durch ein anderes ersetzen?
-

 Berühmtheiten3 Wochen ago
Berühmtheiten3 Wochen agoKönig Charles III. setzt im Kampf gegen Krebs auf medizinisches Cannabis
-

 Cannabis für den Freizeitgebrauch4 Tagen ago
Cannabis für den Freizeitgebrauch4 Tagen ago80 niederländische Coffeeshops beginnen, nur noch legales Cannabis zu verkaufen
-

 Berühmtheiten2 Wochen ago
Berühmtheiten2 Wochen agoDer neueste Film von Cheech & Chong
-

 Cannabis in Frankreich3 Wochen ago
Cannabis in Frankreich3 Wochen agoFrankreich wird Cannabisblüten für medizinische Zwecke erlauben, aber nur in gesicherten Patronen
-

 Cannabis in Tschechische Republik1 Woche ago
Cannabis in Tschechische Republik1 Woche agoTschechische Allgemeinmediziner dürfen nun Cannabis verschreiben
-

 Experimente mit therapeutischem Cannabis4 Wochen ago
Experimente mit therapeutischem Cannabis4 Wochen agoFrankreich verlängert weitere Experimente mit medizinischem Cannabis bis zur allgemeinen Einführung
-

 Cannabis in der Schweiz4 Wochen ago
Cannabis in der Schweiz4 Wochen agoExperimente mit legalem Cannabis in der Schweiz zeigen einen Trend zum „risikoarmen Konsum“
-

 Spannabis4 Wochen ago
Spannabis4 Wochen agoDie Gewinner des Spannabis Champions Cup 2025